| Der Poststrukturalimus - Kurzdarstellung der Charakteristika und Wirkung
Aus Anlass der Lektüre des Buchs
Poststrukturalismus von Catherine Belsey (Reclam, Stuttgart 2013. Englisches Original: Poststructuralism. A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York 2002)
beschäftige ich mich noch einmal mit dem Poststrukturalismus.
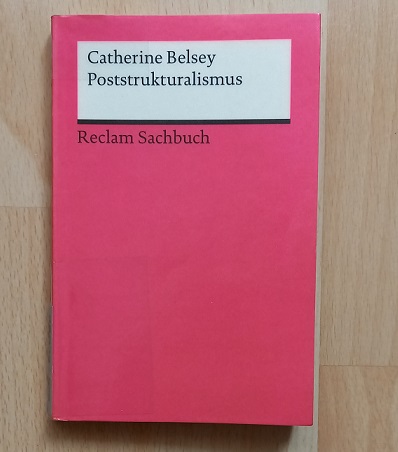
Meine Geschichte mit dem Poststrukturalismus
Zum ersten Mal bin ich dem Poststrukturalismus in der Zeit meines Studiums von 1991-97 (Philosophie / Spanisch (Romanistik) an der Universität Wien begegnet. Man hat mir diese Denkrichtung, die ich nicht verstehen konnte und die ich bis heute nicht verstehe, dort aufgezwungen. Ich sehe das, was mir damals passiert ist, als geistige Misshandlung an, die mich in meiner geistigen Entwicklung behindert hat. Sie war auch mit dafür verantwortlich, dass ich beruflich nie an der Universität Fuß fassen konnte, denn an einem Ort, wo es Voraussetzung war, dass man poststrukturalistische Überzeugungen annahm, um zur akademischen Gemeinschaft dazugehören zu dürfen, war ich fehl am Platz.
Am unmittelbarsten wurde mir der Poststrukturalismus durch Prof. Friederike Haussauer aufgezwungen, bei der ich ein Seminar besuchte, in dem wir die novelas ejemplares von Miguel de Cervantes und von Maria de Zayas y Sotomayor nach poststrukturalistischen Methoden der Textanalyse interpretieren mussten. Verstärkt wurde ihre Einflussnahme (Gehirnwäsche) auf mein Denken durch ihr furchtbares Skriptum: Was ist Literatur? Einführung in die Romanistik (Hispanistik/Galloromanistik) und die Allgemeine Literaturwissenschaft. (Wien 1998). Wenn man sich dafür interessieren würde, wie es bewerkstelligt werden kann, dass ein literaturinteressierter Mensch wie ich aus der Literaturwissenschaft vertrieben wird, könnte man meinen Fall studieren.
Aber es wäre auch ungerecht, Frau Prof. Hassauer allein die Schuld an meiner geistigen Misere während meiner Studienzeit an der Universität Wien zu geben. Es gab damals viele Anhänger des Poststrukturalismus. Die Universität, soweit ich das wahrnehmen konnte, war imprägniert vom Poststrukturalismus. Poststrukturalismus war das Neue, von dem man etwas erwarten konnte, während die alten Denkweisen, die er bekämpfte, etwas waren, von dem man keine sinnvollen Welterklärungen erwarten konnte und die als lächerlich angesehen werden mussten. Dominanter war der Einfluss des Poststrukturalismus im Spanischstudium spürbar; das Philosophiestudium erlebte ich eher als den Ort, wo sich Leute versammelten, die mit unverständlichen, paradoxen und hochtrabenden Aussagen zu beeindrucken versuchten.
Was ist der Poststrukturalismus eigentlich?
Ja, wenn ich nochmal über den Poststrukturalismus nachdenke, wie würde ich (z.B. für jemanden, der nichts über ihn weiß) zusammenfassen, was das ist? Nun, ich würde sagen: Der Poststrukturalismus ist eine Ideologie und keine wissenschaftliche Theorie. Und zwar ist er eine politische Ideologie – was auch darauf hindeutet, dass er mit ehrlicher Wahrheitssuche wenig zu tun hat. Als Ideologie bezeichne ich den Poststrukturalismus deshalb, weil er nicht ergebnisoffen nach etwas sucht, sondern weil von Anfang an feststeht, was er finden will.
Außerdem besteht der Poststrukturalismus in einer Entwertung der individuellen Erfahrungswirklichkeit, was zur Folge hat, dass einem als Einzelmenschen alle Werkzeuge zum Denken weggenommen werden. (D.h. man kann weiterhin denken, wie man will; aber man kann mit den anderen Menschen nicht mehr darüber reden, wenn diese poststrukturelle Überzeugungen haben und sie dein Denken als verfehlt ansehen.) Dieses zweite Charakteristikum des Poststrukturalismus erschaffen die Poststrukturalisten durch die völlige Verlagerung auf die gesellschaftliche Ebene, auf die Ebene der Sprache und ihrer Struktur. Die Überzeugung der Poststrukturalisten lässt sich in etwa so zusammenfassen: „Was du denkst, ist völlig unerheblich, denn du bist ja nur ein Ergebnis der Kultur und der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse!“
Es ist nur konsequent, dass ich nicht an einem Ort bleiben wollte, wo ich zwar denken musste, mein Denken aber entwertet wurde.
Poststrukturalistische Literaturanalyse
Was mussten wir denn tun in Prof. Hassauers Literaturseminar? Wir mussten die Novellen von Cervantes und von Maria de Zayas so lesen, als hätten sie keinen Autor und in ihnen Gegensätze finden (warm-kalt, drinnen-draußen, trocken-feucht, tugendhaft-nicht tugendhaft), die uns Aufschluss über die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse im spanischen Siglo de oro (ca. 1550-1660) geben könnten. Wer das nicht wollte, der durfte die Erzählungen, die wir lasen, nicht auf irgendeine andere Weise interpretieren, sondern konnte höchstens aus dem Kurs ausscheiden (auf die Gefahr hin, ein Semester zu verlieren oder keinen anderen Kurs zu finden, mit dem man die für den Abschluss des Studiums nötige Note im Fach Literaturwissenschaft erlangen konnte).
Ich will es zusammenfassen: Man interpretiert Literatur und was macht man dabei? – Man sucht Herrschaftsverhältnisse! Damit will ich sagen: Ja, freilich wird man welche finden. Und es werden auch genau diejenigen sein, von denen man vorher schon überzeugt gewesen ist. (Wenn man z.B. der Meinung gewesen ist, dass im spanischen Siglo de oro das Patriarchat geherrscht hat, wird man in den literarischen Werken nicht finden, dass die Frauen die Männer unterdrückt haben.) Die poststrukturalistische Literaturanalyse ist also ein abgekartetes Spiel, etwas, das Schopenhauer eine petitio principii genannt hätte, also man genau dasjenige von vornherein voraus, von dem man dann angibt, es bei der Untersuchung gefunden zu haben.
Catherine Belsey beschreibt nach den Herrschaftsverhältnissen in ihrem Buch auch. Sie beschreibt sie nicht als Ideologie, sondern als die Aufdeckung der Ideologie. Dahinter stehen folgende Annahmen: Die Ideologie, das sind die literarischen Werke. Die literarischen Werke wurden mehr oder weniger im Auftrag der Herrschenden geschrieben und sie haben den Zweck, den Leserinnen und Lesern die Herrschaftsverhältnisse, die in Wirklichkeit künstlich und von Menschen geschaffen sind, als natürlich und deshalb unveränderlich erscheinen zu lassen. Die Gegensätze oder Unterschiede (Differenzen), die wir in den Novellen suchen sollten, sind nach Überzeugung der Poststrukturalisten Ausdrucksweisen dieser Herrschaftsverhältnisse: Durch sie findet jeder Mensch seinen Platz in der Gesellschaft und verhält sich dort brav und angepasst.
„Marxismus und Ideologie
An dieser Stelle der Argumentation werden Sie vielleicht bemerkt haben, dass das Buch Mythen des Alltags ein Vokabular verwendet, das aus dem Marxismus stammt. Barthes war selbst zwar kein Marxist, aber im Paris der Nachkriegs-[S. 49]zeit konnte man kein Intellektueller sein, ohne den Marxismus zu berücksichtigen. […]
[Es folgt hier ein Absatz über das Buch Die deutsche Ideologie von Marx/Engels, in welchem „Ideologie“ definiert wird so wie im folgenden Absatz:]
Die „Ideologie“, so Marx‘ und Engels‘ Vorschlag, besteht aus denjenigen Formen des gesellschaftlichen Austauschs, die den zur jeweiligen Zeit herrschenden Eigentumsverhältnissen entsprechen. […] Und in einem Beispiel, das die Semiologie schon vollkommen vorwegnimmt, weisen Marx und Engels darauf hin, dass wir unter der Herrschaft des Feudalismus viel von „Ehre“ und „Loyalität“ hören, dass aber zu dem Zeitpunkt, als der Kapitalismus an [S. 50] die Macht kommt, rasch „Freiheit“ und „Gleichheit“ (der Chancen, versteht sich) deren Platz einnehmen.
Darüber hinaus machen sie geltend, dass die herrschende Klasse ihre Ansichten mit dem Charakter der Unvermeidlichkeit ausstatten und jedermann davon überzeugen muss, dass diese Vorstellungen die einzig ernstzunehmende Option sind, die einzige Art und Weise, die Welt zu verstehen, die wirklich vernünftig und gültig ist, um ihre eigenen Interessen als die gemeinsamen Werte aller Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft auszugeben.“
(S. 49-50) |
Wenn Sie das Zitat aufmerksam lesen, werden Sie finden, dass Marx und Engels in ihrem Buch Die deutsche Ideologie, das sie im Jahr 1845 schrieben, ein Beispiel brachten, dass die Semiologie, also die strukturalistische Sprachwissenschaft, „schon vollkommen vorwegnimmt“. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist dass das, was die Poststrukturalisten machen, nicht neu ist, sondern Denkmöglichkeiten umfasst, die auch schon vor Ferdinand des Saussure (dem Gründer der strukturalistischen Sprachwissenschaft) möglich und denkbar waren.
Auch würde ich nicht sagen, dass der Poststrukturalismus marxistisch ist, sondern umgekehrt, dass Poststrukturalismus und Marxismus beide die Manie haben, alles auf der Ebene der Gesellschaft zu erklären. Oder im Fall des Poststrukturalismus eben auf der Ebene des gesellschaftsweiten Symbolsystems der Sprache, was auf das Gleiche hinausläuft.
Und was man nun auf der gesellschaftlichen Ebene finden will, das sind Herrschaftsstrukturen. Ist klar, denn wenn man sich für die individuelle Ebene nicht interessiert, dann interessiert man sich auch nicht für die Schicksale der dargestellten Personen und muss anstatt dessen nach etwas anderem suchen, das man für lohnenswert hält – eben die Herrschaftsverhältnisse.
Aber mit den Herrschaftsverhältnissen hatte es das auf sich, dass wir genau das finden wollten, was wir zu suchen vorgaben. In der Zeit, in der ich studierte, war es sehr en vogue gegen die Unterdrückung der Herrschenden und der Reichen zu sein (politische und wirtschaftliche Ausbeutung), gegen die Unterdrückung der Frau und gegen die Unterdrückung anderer Kulturen (Kolonialismus). Also fanden wir diese Aspekte auch in den literarischen Werken, die wir untersuchten. Das ist so ähnlich wie wenn man ein Kaninchen im Hut findet, nachdem man es vorher in den Hut hineingetan hat. Großartig! Das kann man ruhig machen, wenn es einen interessiert. Nur soll man nachher nicht behaupten, man habe literarische Werke interpretiert, indem man das gemacht hat!
Catherine Belsey liefert ebenfalls ein Beispiel für so eine Literaturinterpretation, die sich selbst so nennt, aber in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Hineinlegen von ideologischer Gesellschaftskritik in einen literarischen Text. Wenn Sie Belseys Interpretation zu dem Textauszug aus George Eliots Adam Bede lesen, werden sie sehen, dass man seine Inhalte unabhängig von jeglicher Literaturinterpretation erlernen kann und sie dann zu jedem Thema sozusagen als Refrain aufsagen kann, d.h. man kann sie auch jedem literarischen Text aufpfropfen:
Textauszug aus: Adam Bede von George Eliot. Die Geschichte spielt in 1799, das Buch wurde um 1860 veröffentlicht:
„„Mit diesem Tropfen Tinte an der Spitze meiner Feder zeige ich Euch die geräumige Werkstatt des Zimmermanns und Bauunternehmers Mr. Jonathan Burge im Dorf Hayslope, wie sie am 18. Juni im Jahre des Herrn 1799 aussah.
Die Nachmittagssonne schien hier warm auf fünf Arbeiter, die hier fleißig an Türen, Fensterrahmen und Wandvertäfelungen werkten. Fichtenholzduft drang von [S. 43] dem zeltförmigen Bretterstapel vor der offenen Tür herein und mischte sich mit dem Duft der Holunderbüsche, die direkt vor dem gegenüberliegenden offenen Fenster ihren sommerlichen Schnee ausbreiteten; die schrägen Sonnenstrahlen durchleuchteten die hauchdünnen Späne, die von dem gleichmäßig arbeitenden Hobel abstiebten, und hoben die feiner Maserung der an der Wand lehnenden Eichentäfelung hervor. Ein zottiger grauer Schäferhund hatte es sich auf einem Haufen dieser weichen Späne bequem gemacht; die Nase zwischen den Vorderpfoten verborgen, runzelte er hin und wieder die Stirn, um einen Blick auf den größten der fünf Arbeiter zu werfen, der in die Mitte eines hölzernen Kaminsimses ein Wappen einschnitzte. Diesem Arbeiter gehörte auch der kräftige Bariton, der den Lärm von Hobel und Hammer übertönte.
>Wach auf mein Seel, der Sonne Licht
Geleit dich durch des Tages Pflicht;
Wirf ab die Trägheit …<“
Wie sie sicher bemerkt haben, wird in diesem Textauszug schwere Arbeit gutgeheißen. Er liefert ein idealisierendes Bild von nicht-entfremdender Arbeit. In einem Dorf, dessen Name auf eine zeitlose, von den finsteren, teuflischen Mühlen der industriellen Revolution unberührten Landschaft hindeutet, singen Männer bei der Arbeit; sie befinden sich im Einklang mit der Welt ringsum. Das Material, das sie bearbeiten – bevor Maschinen die Macht übernahmen -, ist natürlichen Ursprungs, und seine Gerüche werden eins („vermischen sich“) mit den Gerüchen der [S. 44] nicht kultivierten Natur außerhalb. Nach dem Kaminsims und der Wandverkleidung zu schließen, besteht die Aufgabe der Männer darin, ein Wohnhaus zu verschönern: Rechtschaffene Arbeit dient der Häuslichkeit und den Werten der Familie. […]“ (S. 43-44)
„Die Ausbeutung hat mit der Tatsache zu tun, dass Adam Bede seine Arbeitskraft für einen Lohn verkaufen muss (er kann es sich nicht leisten, [S 56] das nicht zu tun), der niedriger ist als das, was sein Arbeitgeber für das geschnitzte Wappen bekommen wird, und viel niedriger als das, was die Käufer des Wappens wahrscheinlich an den Pachten verdienen, die sie auferlegen.“ (S. 55-56) |
Interpretatonen dieser Art produzierten auch wie als StudentInnen damals aus den Novellen von Miguel de Cervantes und Maria de Zayas. Dabei hätte es durchaus interessant und lehrreich sein können, wenn wir uns wirklich mit den Geschlechterverhältnissen im Siglo de oro anhand dieser literarischen Texte beschäftigt hätten, so wie es das Programm dieses Seminars war. Aber das taten wir ja nicht, wir bestätigten bloß unsere Vorurteile über die Geschlechterverhältnisse, indem wir sie in den Texten suchten und fanden.
Was Wissenschaft ist (und was nicht)
„In den Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft hatte Saussure geschrieben:
„Man kann sich also vorstellen eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht […] wir werden sie Semeologie (von griechisch s?meîon, >Zeichen<) nennen. […] Die Sprachwissenschaft ist nur ein Teil dieser allgemeinen Wissenschaft […]
Auf diese Weise wird man nicht nur das sprachliche Problem aufklären, sondern ich meine, daß mit der Betrachtung der Sitten und Bräuche usw. als Zeichen diese Dinge in neuer Beleuchtung sich zeigen werden, und man wird das Bedürfnis empfinden, sie in die Semeologie einzuordnen und durch die Gesetze dieser Wissenschaft zu erklären.“
Wir dürfen wahrscheinlich den Begriff „Wissenschaft“ hier nicht zu wörtlich verstehen. In den frühen Jahren des [S. 39] 20. Jahrhunderts, als Saussure jene Vorlesungen hielt, die schließlich zu den Grundfragen wurden wurde die Wissenschaft hochgeschätzt. Jede neue Erkenntnis, die ihr Geld wert war, behauptete, eine Wissenschaft zu sein. (Im selben historischen Augenblick stellte Freud die gleiche Behauptung für seine in den Kinderschuhen steckende Psychoanalyse auf.) Jedenfalls umfasst der Begriff science („Wissenschaft“) im Französischen mehr als im Englischen. Er bedeutet jegliches exaktes oder methodisches Wissen, einschließlich dessen, was wir unter wissenschaftlicher Erkenntnis verstehen, ist aber nicht auf diese beschränkt.“ (S. 38-39) |
Das ist ein interessanter Punkt, denn so hat man uns das während meines Studiums nicht beigebracht. Unsere akademischen Lehrerinnen und Lehrer haben uns tatsächlich die Sprachwissenschaft Saussures und auch die Psychoanalyse Freuds als Wissenschaften präsentiert! Seitdem habe ich viel über Wissenschaft geschrieben und philosophische Arbeitsblätter zur Wissenschaftstheorie verfasst, und meine Motivation dabei stammte zum größten Teil eben aus jenen Ungereimtheiten, die daraus entstehen, dass man verschiedene Disziplinen, die in unterschiedlichem Ausmaß Anspruch auf Exaktheit stellen können, in einen Topf wirft und sie alle „Wissenschaft“ nennt.
Aber genau das haben unsere akademischen LehrerInnen gemacht. Sie haben uns Saussures Sprachwissenschaft als Wissenschaft präsentiert und dadurch einen Anspruch auf die Alleinrichtigkeit erhoben, der sich dann im Literaturwissenschaftsskriptum von Frau Prof. Hassauer fortgesetzt hat: „Das ist die alleinrichtige Weise, Literatur zu interpretieren!“
Ist der Autor ganz tot? Ist der ganze Autor tot?
Auch das Folgende haben uns unsere akademischen LehrerInnen während meiner Studienzeit anders erzählt:
„Der Leser
Roland Barthes will zwar, dass wir den Text selbst lesen, und nicht etwas anderes, von dem wir meinen, dass es uns einen Schlüssel zum Verstehen oder eine Garantie für die Richtigkeit unserer Interpretation geben könnte. […]
Frage: Was hatte Barthes gegen Autoren? Meinte er etwa, dass Bücher sich selbst schreiben würden?
Antwort: Es ging ihm nicht so sehr um den Autor als vielmehr um dessen Autorität. Sein eigentliches Ziel war die Institution der Kritik, die ihre Kontrolle über die Bedeutung literarischer Texte dadurch aufrechterhält, dass sie die Kenntnis des Lebens und der Zeit des Autors zum Schlüssel für die einzig mögliche Lesart macht. Die Autorität des Autors wird dann als die Erklärung des Werks, als das endgültige Signifikat ins Spiel gebracht. Damit wird die Möglichkeit neuer Interpretationen, die darauf beruhen, dass man sich den Signifikanten selbst zuwendet – Textmerkmalen, einschließlich der Handlung, der Metaphern, der Gattung, Anspielungen auf andere Texte oder überraschende Enttäuschungen von Erwartungen -, ausgeschlossen.“
(S. 34-35) |
Nein, ich kann bestätigen, dass es unseren akademischen LehrerInnen beim „Tod des Autors“ nicht nur darum ging, mit dem Vorurteil zu brechen, dass man ein literarisches Werk erst dann richtig verstanden hätte, wenn man die Intention des Autors verstanden hat (Das berühmte: „Was wollte der Autor uns damit sagen?“) Ja, schon auch, aber nicht nur: Sie wollten schon auch, dass der Autor richtig tot sei. Sie wollten uns glauben machen, dass das literarische Werk in Wirklichkeit von der Kultur der Epoche, in der der Autor gelebt hatte, geschrieben worden sei – und dass die konkrete Person des Autors (oder der Autorin) egal sei: Das Werk hätte genauso gut von jemand anderem geschrieben werden können.
Interessant finde ich den Satz von Belsey: „Roland Barthes will zwar, dass wir den Text selbst lesen, und nicht etwas anderes, von dem wir meinen, dass es uns einen Schlüssel zum Verstehen oder eine Garantie für die Richtigkeit unserer Interpretation geben könnte.“ Denn mir war damals schon klar: Das Kontextwissen über den Autor wurde in der poststrukturalistischen Literaturwissenschaft von Prof. Hassauer eben durch ein anderes Kontextwissen ersetzt: Statt uns mit dem Leben des Autors zu befassen, studierten wir die gesellschaftlichen Verhältnisse der Epoche sowie die literarischen Gattungen dieser Zeit samt ihrem üblichen Gebrauch. Mir erschien das eher wie ein Streit zwischen zwei Gelehrtengenerationen: Während die alte Generation noch an dem „Was will uns der Autor sagen?“ hing, wollte die jüngere Generation nichts mehr davon wissen.
Aber es wären nicht Gelehrte, wenn sie uns LeserInnen die Texte einfach so lesen ließen, ohne zu behaupten, dass wir noch etwas anderes bräuchten, das „uns einen Schlüssel zum Verstehen oder eine Garantie für die Richtigkeit unserer Interpretation geben könnte“. Um ihre eigene Existenz (und Ihre Stellung als fixangestellte MitarbeiterInnen an der Universität) rechtfertigen zu können, müssen Gelehrte immer behaupten, dass es des ganzen Wissens, das sie sich in ihrem Leben angelesen haben, bedarf, damit wir leben können und die Gesellschaft fortbestehen kann, denn sonst würden sie sich selbst überflüssig machen. Es ist von daher also völlig undenkbar, dass die LiteraturwissenschaftlerInnen jemals zugeben könnten, wir LeserInnen könnten ein Werk ohne weitere Hilfe lesen! Nur worin diese Hilfe besteht, das ist eben von Gelehrten- zu Gelehrtengeneration unterschiedlich.
Der „Tod des Subjekts“
Mit dem folgenden Thema komme ich auf den Grund zu sprechen, warum der Poststrukturalismus für das Denken so schädlich ist: Es nimmt uns einfach den denkenden Menschen weg! Es behauptet, den Menschen, also das Subjekt, gibt es gar nicht, weil dieser nur eine Auswirkung von gesellschaftlichen Effekten ist. Das mag ja alles stimmen: Man kann schließlich von allem abstrahieren (das heißt: absehen), auch vom Menschen, und die Soziologie tut das seit langem; nur soll man nicht dann vom Subjekt absehen, wenn man es eigentlich sehen will bzw. wenn es wichtig ist.
Betrachten Sie doch einmal das folgende Zitat und schauen Sie, wie Catherine Belsey auf das „weitverbreitete Missverständnis“, der Poststrukturalismus beraube uns unserer Handlungsmacht im eigenen Leben, reagiert und wie sie auf die dahinterstehende Frage antwortet! Sie werden sehen, dass Belsey überhaupt nicht auf die Frage antwortet. Die Frage lautet: Wie könnten wir denn unser eigenes Leben gestalten, wenn es uns als Handlungssubjekte gar nicht gibt? Und Belseys Antwort lautet: Die gesellschaftlichen Bedeutungen sind veränderlich, deshalb können wir sie auch verändern.
Aber diese Antwort lässt immer noch die Frage offen, wie wir denn die gesellschaftlichen Bedeutungen verändern könnten (und dadurch gegen die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse) Widerstand leisten könnten, wenn es uns gar nicht gibt?
Was übrigens das mit dem „freien, uneingeschränkten Ursprung unserer eigenen Überzeugungen und Werte“ betrifft, so weiß ich nicht, was damit gemeint ist: Zur Definition des Subjekts gehört ja nicht (und hat auch nie gehört), dass es die ganze Welt aus sich selbst heraus erschafft. Das sieht also nach einem Strohmannargument aus.
„Programmiert?
Ein weitverbreitetes Missverständnis über die poststrukturalistische Theorie lautet, dass diese uns der Macht der Entscheidung oder des Handelns als Akteure in unserem eigenen Leben beraubt. Das ist abermals binäres Denken: Wenn das Subjekt eine Auswirkung der Bedeutung ist, wenn wir nicht der freie, uneingeschränkte Ursprung unserer eigenen Überzeugungen und Werte sind, so die Annahme, können wir wohl nichts Besseres als künstliche Intelligenzen sein, außerhalb unserer selbst darauf programmiert, nach Verhaltensmustern zu handeln, die anderswo festgelegt worden sind.
So haben die meisten poststrukturalistischen Denker jedoch nicht argumentiert. Die Dekonstruktion impliziert ganz im Gegenteil, dass Bedeutungen nicht unveränderlich im voraus gegeben sind, sondern verändert werden können. Foucault betont in seinem ganzen Werk die Möglichkeit, des Widerstands, da Macht immer Macht über etwas oder jemanden ist. (Niemand beansprucht Mach über Rüben.) In Foucaults Modell ist die Macht beweglich, flexibel, übertragbar. Sowohl seine als auch Derridas Position implizieren auf unterschiedliche Weise ethische und politische Entscheidungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeit. Slavoj Žižek und Jean-François Lyotard setzen auf jeweils verschiedene Weise Konflikte als gegeben voraus und nehmen an, dass wir uns für eine Seite entscheiden“ (S. 130) |
Es kommt also nicht in erster Linie darauf an, dass die Gesellschaft veränderlich ist. Sondern in erster Linie kommt es darauf an, dass Handlungssubjekte existieren, die aus eigenem Antrieb aktiv werden und somit denken oder handeln können. Wenn man den Menschen zum Effekt von sozialen und kulturellen Entwicklungen erklärt, dann darf man sich nicht wundern, wenn das „Missverständnis“ entsteht, dass uns die poststrukturalistische Theorie „der Macht der Entscheidung oder des Handelns als Akteure in unserem eigenen Leben beraubt“. Das tut sie tatsächlich, das ist auch kein Missverständnis. Und ich weiß auch nicht, wie die Anhänger der poststrukturalistischen Theorie selbst damit leben können; es sei denn, sie behandeln die Sache wie Frau Belsey, die in einem Absatz eine Frage stellt und im nächsten Absatz schon wieder vergessen hat, welche Frage sie beantworten wollte.

Erkenntnisse aus der Lektüre von Belseys Buch Poststrukturalismus
Erstens, das Subjekt taucht immer wieder auf
Belsey erzählt die Geschichte von dem französischen Hermaphroditen Herculine Abel Barbin, der mit 29 Jahren Selbstmord begangen hat, weil er mit seiner Identität – seinem Subjekt – nicht zurechtkam. Abel Barbin war als Mädchen aufgewachsen und erst im Erwachsenenalter nach einer ärztlichen Untersuchung dem männlichen Geschlecht zugeordnet worden. In Wirklichkeit trug er/sie „rudimentäre Ausprägungen der Geschlechtsorgane beider Geschlechter und ohne Gebärmutter“ (S. 73).
„Ein schwieriges Leben
Mit all diesen Unterscheidungen im Hintergrund ist es für keinen von uns erfreulich, ein Subjekt zu sein, zumindest manchmal. Deshalb ist es kein Wunder, dass Abel Barbin entschied, dass er genug hatte.
Herculines Körper war mehr männlich als weiblich; aber als Subjekt war ihre kulturelle Konstruktion mehr weiblich [S. 100] als männlich. Sich zu verlieben, Subjekt und Organismus im gemeinsamen Handeln zusammenzuführen, brachte eine Krise hervor. Da Abel dem, was der Arzt sein wahres Geschlecht nannte, zugewiesen wurde, musste er über Nacht eine neue Subjektivität schaffen. Das war unmöglich, und er wurde verwirrt, innerlich zerrissen, depressiv. Vorausgesetzt, dass die Psychoanalyse bezüglich des Unbewussten recht hat, wissen wir alle nicht so richtig, was wir meinen, wenn wir „ich“ sagen. Abel hatte dieses Problem hoch zehn. Ein Leben unter solchen Umständen schien unmöglich, und er setzte ihm ein Ende.“ (S. 99-100) |
Ich finde, es ist doch erstaunlich, dass eine solche Geschichte, die die grundlegende Bedeutung der Subjektwerdung im Leben eines Menschen betont, in einem Buch über Poststrukturalismus überhaupt vorkommt. Die Ursache dafür würde ich mir folgendermaßen erklären: Der Poststrukturalismus verhält sich parasitär gegenüber dem Subjekt. Offiziell behauptet er immer, das Subjekt gäbe es gar nicht, aber inoffiziell und im Geheimen steht es im Mittelpunkt der poststrukturalistischen Aufmerksamkeit wie der berühmt-berüchtigte „blinde Fleck“ des Sehens. Es geht ja am Ende immer wieder nur um das Subjekt, denn für wen denken wir denn, wenn nicht für das Subjekt? Für wen erforschen wir, wenn nicht für das Subjekt? Wer sollte denn handeln, wenn nicht das Subjekt?
Wir Menschen sind Subjekte und tun alles nur, um als Subjekte zu überleben und unsere Lebensqualität zu erhöhen. Man kann nichts lernen aus einer Theorie oder Methode, bei der nicht verständlich ist, was das Subjekt davon hat, wenn es sich mit ihr beschäftigt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man eine Theorie wie den Poststrukturalismus, der uns von unserem Selbstverständnis als Subjekte abbringen will, auffassen kann: Es gibt verschiedene Denkweisen, die uns entmutigen wollen, indem sie uns einreden wollen, dass wir zu schwach sind, unser Leben zu gestalten, und dass wir bloß der Spielball von anderen, mächtigeren Kräften sind.
Eine Variante davon ist das in Wien besungene: „Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nichts!“ Eine andere Variante ist der Poststrukturalismus. Damit will ich nicht sagen, dass diese Einsicht nicht in vielen Fällen zutreffend ist, sondern nur: Wenn man sie in den Mittelpunkt stellt, wird man es verabsäumen, nach den wenigen Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen, die man tatsächlich hat. Insofern ist der Poststrukturalismus etwas für Menschen, die es sich bequem machen wollen und für solche, die aufgeben wollen, aber natürlich auch für solche, die laut klagen und protestieren wollen.
Man kann hemmungslos protestieren, wenn man sich sicher ist, dass die Schuld nie bei einem selbst, sondern immer bei den Herrschaftsverhältnissen liegt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass Foucault der Ansicht war, man könnte der Macht Widerstand leisten: So wie ich ihn verstanden habe, führt Widerstand gegen die Macht immer nur zur Herausbildung von noch perfideren Formen von Macht, die sich menschenfreundlich geben und als Macht schwerer erkennbar sind, sodass wir uns also in einem geschlossenen Labyrinth befinden. Jede Verbesserung erweist sich als Verschlimmbesserung und macht alles nur noch schlechter, wie in einer richtigen Verschwörungstheorie.
Zweitens, das mit dem Signifikanten und dem Signifikaten ist ein Blödsinn!
Die zweite Einsicht, die ich jetzt beim Lesen von Catherine Belseys Buch gehabt habe, ist mir persönlich noch wichtiger: Die Strukturalisten und Poststrukturalisten haben immer von Zeichen geredet. Das hat ihren Diskurs für mich verschlossen und ihn meinem Denken unzugänglich gemacht, weil ich es gewohnt bin, ausgehend von „Phänomenen“ zu denken. Aber wenn ich das, was ich in dem Buch von Belsey vom Poststrukturalismus sehe, betrachte, dann könnte man es genauso gut als Phänomen ansehen, insbesondere weil Phänomene auch einen Verweischarakter haben: Ich sehe immer etwas als etwas.
Konkreter: Die wesentlichsten Einsichten von Ferdinand de Saussure bestehen darin, dass, erstens, das Zeichen aus Signifikant (Bezeichnendes) und Signifikat (Bezeichnetes) besteht und dass, zweitens, die Bedeutung eines Zeichens nicht durch seinen Bezug auf dasjenige „Ding in der Welt“ entsteht, auf das es sich bezieht (Referenz), sondern durch seine Differenz zu anderen Zeichen im Zeichensystem. Diese beiden Einsichten Saussures führen dazu, dass die postrukturalistischen LiteraturwissenschaftlerInnen immer von „Signifikanten“ sprechen, wenn sie Texte untersuchen – und das verwirrt mich, weil ich nicht weiß, wovon sie reden.
Es verwirrt mich umso mehr, weil sie, indem sie von „Signifikanten“ reden, in Wirklichkeit von den mit ihnen bezeichneten „Signifikaten“ zu reden scheinen. Ein Beispiel von Belsey: Unter der Überschrift „Das Primat des Signifikaten“ (S. 25) bringt Belsey das Gedicht „In a Station of the Metro“ von Ezra Pound vor, um damit zu betonen, dass in der Dichtung die Signifikanten wichtiger sind als die Signifikate. Wenn Sie sich Belseys Interpretation dieses Gedichts ansehen, dann sehen Sie, wie viel Mühe sie sich geben, um von den Signifikaten, also von den Phänomenen, abzulenken. Sie sagt zum Beispiel: Ja, aber die Feingliedrigkeit und Verletzlichkeit der Gesichter wäre uns in der Wirklichkeit gar nicht aufgefallen (=sie fällt uns nur auf, wenn wir in der Dichtung auf sie aufmerksam gemacht werden)! Darauf kann ich nur antworten: Ja, wenn wir in der Wirklichkeit nicht genau hinschauen, dann fällt sie uns nicht auf.
“The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.”
(Das Erscheinen dieser Gesichter in der Menge:
Blütenblätter auf einem nassen, schwarzen Ast.)
Und doch, so könnten Sie einwenden, sind diese Gesichter und Blütenblätter mehr als Signifikanten. Sie existieren doch gewiss als Dinge? Wir >sehen< ihren Bezugspunkt vor unserem geistigen Auge. […]
In gewisser Weise, ja. Das Gedicht isoliert jedoch diese Bilder, die so ähnlich und doch so verschieden sind, vom „Rauschen“, das sie in der Wirklichkeit umgeben würde. Der Signifikant trennt den Vergleich, den er schafft, von den individuellen Erlebnissen, wie sie in einer Welt der Referenz existieren könnten, und stellt dabei eine Menge von Assoziationen her – z.B. die Feingliedrigkeit und Verletzlichkeit von Gesichtern - , die die Wirklichkeit von Menschenmengen und Bäumen sicherlich ganz an den Rand unseres Interesses verbannt. Diese Assoziationen beruhen (natürlich) auf Differenzen – auf jenen zwischen großen Menschenmengen und kleinen Gesichtern, dunklen Zweigen und blassen Blütenblättern oder auf dem Kontrast zwischen massiven und zerbrechlich wirkenden Dingen.“ (S. 27) |
In einem Wort, Wir haben es bei den Signifikaten mit demselben zu tun wie beim Subjekt: Der Strukturalismus/Poststrukturalismus profitiert in parasitärer Weise vom Signifikat, also von den Phänomenen, aber er ist bemüht, das zu verschleiern.
Belsey bringt noch ein zweites Beispiel, das Gedicht „The Red Wheelbarrow“ von Carlos Williams:
„so much depends
upon
a red wheel
barrow
glazed with rain
water
beside the white
chickens”
Auch bei diesem Gedicht ist sie bestrebt, die Vorstellungsbilder, die der Text hervorruft zu entwerten, indem sie sagt, mit ihren knalligen Farben (rot und weiß) ganz “ohne Schatten und Schlamm” würden sie die Realität auf einem Bauernhof nicht realistisch wiedergeben, sondern das Gedicht lasse die Schiebetruhe eher wie eine Spielzeugschiebetruhe für Kinder aussehen. Aber mit dem, was sie sagt, erreicht sie bei zumindest mir genau das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigt: Sie zeigt auf, wie sehr das Gedicht von den bildlichen Vorstellungen, die es erzeugt, abhängt und seine gesamte Kraft aus ihnen zieht.
Als Student habe ich es unwidersprochen hingenommen, dass ein Zeichen aus Signifikant und Signifikat besteht. Heute würde ich sagen, dass ist Unsinn: Ein Zeichen hat kein Signifikat. Es weist auf etwas hin; aber was das ist, worauf es hinweist, das ist diskutabel. Und vor allem gehört das Signifikat nicht zum Zeichen. Das Zeichen hat auch keinen Signifikanten, sondern es ist der Signifikant. Nichts anderes bedeutet ja „Zeichen“, als dass es auf etwas verweist. Aber das Zeichen selbst ist nichts anderes als der Zeichenkörper (z.B. das Verkehrsschild oder irgendein bestimmtes Wort).
Die Erkenntnis aus meiner Belsey-Lektüre besteht darin, dass die Poststrukturalisten fortwährend von Signifikanten reden oder zu reden behaupten, aber in Wirklichkeit reden sie von Signifikaten, also von Phänomenen. Sie könnten also ohne weiteres gleich von Phänomenen reden, dann würden sie mich nicht verwirren und ich könnte an der Diskussion teilnehmen.
Wer es nicht glauben will, betrachte noch einmal genau die beiden Gedichtbeispiele von Belsey: Die Feingliedrigkeit und Verletzlichkeit der Gesichter mögen von der Vorstellung (=dem Signifikat) von Blütenblättern auf einem nassen, schwarzen Ast herkommen, aber vom Signifikanten (= von den Wörtern „Blütenblätter auf einem nassen, schwarzen Ast“) kommen sie nicht.
Dasselbe können wir im „Wheelbarrow“-Gedicht sehen. Und wenn der Einwand dagegen lautet, dass die Phänomene durch die Signifikanten in gewisser Weise angeordnet sind bzw. manche Dinge nicht erzählt werden (Schatten und Schlamm), dann ist darauf zu antworten, dass auch Phänomene in der Realität immer irgendwie angeordnet finden bzw. Menschen Mühe darauf verwenden, sie für unseren Blick anzuordnen (denken Sie an ein schön gestaltetes Schaufenster eines Geschäfts oder den Tisch für eine feierliches Bankett).
Schließlich kann man auch die sprachlichen Zeichen oder die Schrift selbst als Phänomene betrachten. Die Tatsache ihres Zeichencharakters gibt ihrer Eigenschaft als Phänomene nichts hinzu. Denn, wie ich gesagt habe, sehen wir ja auch Phänomene immer „als etwas“, d.h. wir interpretieren sie. Z.B. sehe ich einen bestimmten Tisch als geeignet zum Schreiben an, während ich einen anderen (einen Teetisch) als nicht dazu geeignet ansehe, weil er zu niedrig ist.
Kurz, indem sie von „Signifikanten“ und „Signifikaten“ reden, erzeugen die Poststrukturalisten eine Verdoppelung der Welt, mit der sie uns beeindrucken und verwirren, sodass wir nicht länger am Gespräch teilnehmen können. (Wenn sie dann noch behaupten, dass ein „kompetenter Sprecher einer Sprache“ sich dadurch auszeichne, dass er den „angemessenen Gebrauch“ der Wörter, die er verwendet, beherrsche, dann überfordern sie mich vollständig, denn eine solche übertriebene Fähigkeit kann ich nicht einmal für meine Muttersprache Deutsch vorweisen.) Es kommt darauf an, wenn sie reden, darauf hinzuhören, auf welche Signifikate, d.h. auf welche Phänomene, sie sich beziehen und sie dann „beim Wort“, d.h. beim Phänomen zu nehmen.
Denn wenn wir miteinander reden, dann verhandeln wir Vorstellungen, Konzepte, Bilder und Gedanken – also allesamt Phänomene oder Signifikate; wir verhandeln keine Wörter miteinander. Und selbst wenn wir Wörter miteinander verhandeln (dort, wo es sich z.B. um eine Definition dreht) geht es uns darum, was das definierte Wort bezeichnet und nicht um den Signifikanten.
Wie mich der Poststrukturalismus in meiner geistigen Entwicklung gehemmt und beschädigt hat
Es ist allzu leicht, sich bei einem bücherfüllenden Thema wie dem Poststrukturalismus in Einzelheiten zu verrennen und das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Deshalb will ich zum Schluss noch einmal sagen, worum es mir geht. Also: Ich habe durch den Poststrukturalismus einen persönlichen Schaden davongetragen. Dieser Schaden bestand (und besteht) darin, dass der Poststrukturalismus (nicht allein, aber unter anderem) dafür ursächlich war, in meiner Umgebung Menschen zu erzeugen, mit denen ich nicht reden konnte (und kann), weil sie gar nicht wissen, was Miteinander-Reden ist.
Und das kommt daher, dass der Poststrukturalismus eine Realitätssicht proklamiert, in der es keine Menschen gibt, die miteinander reden, um einander etwas mitzuteilen und voneinander zu lernen. Zum einen gibt es im Poststrukturalismus keine Menschen, weil alle Subjekte ja nur passive Effekte ihrer Kultur und Epoche sind; zum anderen wird z.B. Literatur ja auch nicht als eine Mitteilung von Mensch zu Mensch gesehen, sondern bloß als ein Ausdruck gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen, mit deren Hilfe die Herrschenden versuchen, die LiteraturkonsumentInnen einzulullen und sie zur Zustimmung zur Herrschaft zu bewegen.
Zur Klarstellung: Ich bin nicht blauäugig und glaube nicht, dass Literatur (publizierte Texte) immer eine absolut intime und ehrliche Kommunikation von einem Menschen mit anderen Menschen ist. Oft haben die Poststrukturalisten Recht in der Annahme, dass etwas nur dazu publiziert wurde, um den Herrschenden zu schmeicheln und/oder Erfolg zu haben. Aber es macht einen Unterschied, wenn ich diese Haltung generalisiere und Texte prinzipiell nicht als persönliche Mitteilungen sehe. Denn wenn man das macht – und der Poststrukturalismus macht das – dann erzeugt das MitstudentInnen und KollegInnen, mit denen man nicht auf einer persönlichen Ebene über die gelesenen Texte reden kann.
- „Wie ist es dir mit dem Text gegangen?“
- „Hat dich die Geschichte beindruckt?“
- „Was hast du für dein Leben aus der Argumentation gelernt?“
Solche Fragen werden dann unmöglich, weil sie von den akademisch verbildeten Mitmenschen schlicht nicht mehr verstanden werden. Ich habe in meinem Spanisch- und Philosophiestudium so gut wie ausschließlich Menschen kennengelernt, die unfähig waren, unmittelbar oder auf einer persönlichen Ebene auf einen Text zu reagieren. Ich habe fast ausschließlich Menschen kennengelernt, die auf meine Frage, was sie in einem bestimmten Text gelesen haben, eine Antwort gegeben haben, von der sie offensichtlich hofften, dass sie in der Öffentlichkeit Eindruck schindet, aber die nicht zum Inhalt hatte, was sie selbst in diesem Text gelesen hatten.
Es ist kein Wunder, dass es auch mir schwergefallen ist, gegenüber solchen durch akademische Ausbildung entmenschten Menschen meine Leseeindrücke zu äußern. Aber das war nicht nur schwierig, sondern auch sinnlos, weil meine Leseeindrücke im Anschluss ja auch nicht diskutiert werden konnten. Sie konnten nicht diskutiert werden, weil meine GesprächspartnerInnen beiderlei Geschlechts ja nicht einmal begriffen, was ich tat: Sie kannten keine Kommunikationsform, in der jemand, der einen Text gelesen hat, eben einfach sagt, was ihm dabei aufgefallen ist. Übrigens unterschieden sich in der Beziehung die PhilosophiestudentInnen nicht von den SpanischstudentInnen.
Die eigenen Gedanken äußern zu können, ist die Voraussetzung dafür, sie mit Anderen diskutieren und weiterentwickeln zu können. Die Ideologie des Poststrukturalismus verhinderte das durch das Aufstellen von Denkverboten. Bei der Analyse von Texten war nur noch eine Herangehensweise erlaubt, die der Dekonstruktion. Alles andere galt als naiv oder rückwärtsgewandt.
Im Rückblick finde ich es ganz unfassbar, was mir da während meiner Studienzeit an der Universität Wien passiert ist. Ich war schließlich ein junger Mensch auf der Suche nach seinem Weg und wusste nicht, wie mir geschieht. So bin ich IdeologInnen in die Hände gefallen, die sich als WissenschaftlerInnen ausgaben und mir Denkweisen aufdrängten, die ich zwar nicht angenommen habe, aber die mich beschäftigt haben und mich an meiner persönlichen Weiterentwicklung gehindert haben.
Nicht nur an der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit freilich, sondern mein Leben hätte völlig anders verlaufen können, wenn ich an der Universität ein offenes Gesprächsklima vorgefunden hätte und die Möglichkeit, mich und meine Gedanken in die akademische Diskussion einzubringen.
(12. April 2022)
|

